| |
06. und 07.Dezember 2003 |
|
| |
Heidelberg
|
|
| |
In diesem Jahr wollten wir uns Heidelberg
in der Vorweihnachtszeit anschauen. Am 06.Dezember ging es nach dem Frühstück
los. Nach gut 2 Stunden Fahrt erreichten wir Heidelberg. Nachdem wir uns
im Hotel angemeldet hatten und einen Stadtplan unser Eigen nennen konnten,
ging es in die Altstadt. |
|
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nachdem wir den Bismarckplatz überquert
hatten ging es über die Hauptstr. zum Universitätsplatz. Hier
ist einer der größten Weihnachtsmärkte. Insgesamt gibt
es 5 Weihnachtsmärkte in
Altstadt. Hier begann unser Rundgang durch die Altstadt.
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Die ersten sehenswerten Gebäude waren
die neue und die alte Universität. 1836 wurde in Heidelberg durch
Kurfürst Ruprecht I die Universität gegründet. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Heidelberger Altstadt ist mit einer der
schönsten Flecken Deutschlands. Von fast jeder Straße hat man
einen Blick auf das weltberühmte Heidelberger Schloss. Hier tummeln
sich jährlich über 3 Millionen Besucher. 1978 wurde der Fußgängerbereich
in der Altstadt fertiggestellt, mit der über 3,5 km langen Hauptstraße.
Links und rechts der Hauptstraße befinden sich die Gassen der Altstadt,
die sich auf der einen Seite bis zum Neckar und auf der anderen Seite
bis zur Plöck erstreckt.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Altstadt kann mühelos zu Fuß
erkundet werden. Wer sich allerdings die vielen versteckten Winkel gerne
zeigen lassen mag, kann dies bei einer Altstadtführung tun. Diese
werden von der Touristinformation am Hauptbahnhof für kleines Geld
angeboten.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte Brücke
Einer der beliebtesten und schönsten Aussichtspunkte in Heidelberg
liegt nur wenige Meter über dem Neckar – die alte Brücke.
Vom Mittelpunkt der Brücke kann man einen wundervollen Blick über
die gesamte Altstadt bis hinauf zum Schloss am bewaldeten Hang des Königsstuhls
genießen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beim Bau der Brücke und des dazu gehörenden
Karlstores integrierte der Architekt beider Bauwerke, Mathias Maier, geschickt
mittelalterlichen Bausubstanz - beispielsweise Teile des ehemaligen Stadttores
– in seine Entwürfe, so dass sich Schießscharten und
martialische Fallgitter nahezu mühelos in die barocke und klassizistische
Architektur des Bauwerkes einfügen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Am 29. März 1945 wurde diese Brücke
zusammen mit anderen Nackarbrücken sinnlos gesprengt. Im Bewusstsein
der Bedeutung der Brücke für das Bild und die Geschichte Heidelbergs,
haben die Bürger der Stadt den Wiederaufbau beschlossen und ausgeführt.
Am 26.07.1947 konnte die Brücke dem Verkehr übergeben werden.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoch über dem bunten Treiben thront eine
- allerdings nicht mehr originale - Herkules-Statue auf der Säule
des barocken Marktbrunnens. Auf den ersten Blick wirkt der grimmige antike
Gott etwas befremdlich, doch seine Gegenwart ist vor dem Hintergrund der
antiken Mythologie leicht zu erklären: Denn Herkules galt im Altertum
als Gott des Handels und Verkehrs und somit auch als Schutzpatron der
Kaufleute.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Marktplatz bildet zusammen mit dem barocken
Rathaus von 1705 und der Heiliggeistkirche das Zentrum des alten Heidelberg.
Damals gehörte der Marktplatz zu den besten Wohnlagen, so dass sich
hier insbesondere wohlhabende Kaufleute niederließen. Die zahlreichen
Brände des 17. Jahrhunderts verschonten allerdings nur eines der
damaligen Gebäude, das noch heute besteht und ein in Heidelberg berühmtes
Hotel beherbergt, das Haus Zum Ritter (Hauptstraße 178), das1592
von dem Tuchhändler Charles Bélier als prächtiger Renaissance-Bau
erbaut wurde.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Ein weiteres der wenigen noch erhaltenen mittelalterlichen
Bauwerke ist die gotische Heiliggeistkirche auf dem Marktplatz. Im 15
Jahrhundert integrierte man in einen „Bibliotheksbau“ in die
Kirche, der es ermöglichte, dass man auf extra dafür eingeplanten
Emporen Bücher aufbewahren konnte. Aus dieser Sammlungen und zahlreichen
späteren Zukäufen und Stiftungen entwickelte sich mit der Zeit
die berühmte „Bibliotheca Palatina“. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peterskirche
Neben der Heiliggeistkirche, dem Hexenturm und dem Wormser Hof ist die
Peterskirche das letzte Bauwerk Heidelbergs aus dem Mittelalter.
Vieles deutet darauf hin, dass die Kirche bereits vor der Gründung
der Stadt Heidelberg am heutigen Standort zu finden war. Bereits im Jahre
1357 wurde die Peterskirche erstmals urkundlich erwähnt. Vor dem
Bau der Heiliggeistkirche durch Kurfürst Ruprecht III. um 1400 war
die Peterskirche alleinige Pfarrkirche der Stadt Heidelberg. Als schließlich
die Heiliggeistkirche im 14. Jahrhundert an ihre Stelle trat, wurde die
Peterskirche der Universität übergeben und diente seitdem als
Universitätskirche. So ist es denn auch nicht verwunderlich, wenn
an Außenwänden der Kirche neben kurfürstliche Hofleute
auch diverse Grabmale
für Universitätsprofessoren aufgestellt sind. Und auch der Gründer
der Universität Marsilius von Inghen (1330-1396) wurde hier bestattet,
sein Grab ist allerdings nicht mehr erhalten. Von 1864 bis 1870 schließlich
wurde die Peterskirche umgebaut, dabei orientierte man sich am neogotischen
Baustil. Trotzdem hat die Peterskirche viel von ihrem mittelalterlichen
Charme behalten.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Geburtshaus des 1 Reichspräsidenten, Friedrich
Eberts 1871 - 1925 Beisetzung auf dem Bergfriedhof. In diesem Haus befindet
sich die Wohnung, in der Friedrich Ebert seine Kindheit und Jugend verbrachte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heidelberger Schloss
Das Schloss Heidelberg gehört zu den bedeutendsten deutschen
Kulturdenkmälern. Vom 13. bis 18. Jahrhundert residierten hier
die Kurfürsten von der Pfalz eine glanz- und wechselvolle Geschichte.
Auf Aufbauphasen folgten Vernichtungen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die künstlerisch bedeutendsten Bauten
des Schlosses stammen aus der Renaissancezeit. Seit dem 19. Jahrhundert
ist Heidelberg für seine romantisch anmutende Schlossruine weltberühmt
und zieht jährlich Hunderttausende von Touristen an.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Schlossruine Heidelberg erhebt sich auf
einer zum Neckartal vorgeschobenen Terrasse des Königsstuhls. Ursprünglich
stand an dieser Stelle eine Burg, die in den Besitz Herzog Ludwigs von
Bayern kam, als dieser 1225 mit der Pfalzgrafschaft belehnt wurde. Allerdings
spielten die Stadt Heidelberg und ihr Schloss in der Geschichte der Pfalzgrafen
erst später, im Laufe des 14. Jahrhunderts, eine wesentliche Rolle.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Bau des unteren Schlosses setzte bis um
das 1400 unter dem Pfalzgrafen Ruprecht III., zu dieser Zeit entstand
auch der Ruprechtsbau. In der zweiten Hälfte des 15. und der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts schließlich erfolgte der Umbau
des unteren Schlosses zur modernen Festung.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurfürst Friedrich II. (1544- 1556) verwandelte
das Schloss in eine prachtvolle Residenz. Mit dem Ottheinrichsbau folgte
der erstePalastbau der Renaissance auf deutschem Boden (1556), 1601 entstand
der Friedrichsbau und 1614 schließlich der Englische Bau. Die Fassade
des Friedrichsbaus schmücken 16 kunstvolle Fürstenstandbilder.
Friedrich IV. ließ ihn während seiner Regierungszeit 1592-1610
errichten.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
In den Jahren 1689 und 1693 wurde das Schloss
im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688-1697) zweimal zerstört.
Nachdem die Kurfürsten Johann Wilhelm, Karl Philipp und Karl Theodor
das Schloss Stück für Stück wieder aufgebaut hatten, legte
ein Blitzschlag und ein nachfolgendes Großfeuer im Jahr 1764 das
Schloss in Schutt und Asche. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts verfiel
das Schloss, eher der französische Emigrant Charles de Graimberg
den historischen Wert der Ruine erkannte sie schützen ließ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toilettenhaus – nach unten offen, nicht
auszudenken, wenn man darunter stand, und oben das stille Örtchen
aufgesucht wurde. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Torturm
Bis heute ist der 1531-1541 unter Kurfürst Ludwig V. entstandene
und von Moritz Lechler erbaute Torturm den Hauptzugang zum Schloss. Im
Untergeschoss des Turms befindet sich ein rund 10 Meter hoher lichtloser
Raum, der meist als Burgverlies bezeichnet wird. Von dem einstmals am
Torturm angebrachten kurpfälzischen Wappen sind lediglich zwei Wächter
sowie zwei Löwen erhalten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Das Große
Fass und der Zwerg Perkeo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Das berühmte große Fass
des Heidelberger Schlosses wurde 1591 im eigens dafür errichteten
Fassbau untergebracht. Ursprünglich besaß Große Fass,
das Kurfürst Johann Casimir in Auftrag gegeben wurde, ein Fassungsvermögen
von 130.000 Litern, 1664 wurde es jedoch durch ein noch größeres
Exemplar mit 195.000 Litern Fassungsvermögen ersetzt. Doch auch dieser
Rekord sollte nicht lange währen, denn das 1751 in Auftrag gegebene
Große Fass, dass noch heute zu bewundern ist, hat ein Fassungsvermögen
von 221.726 Litern.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unter Kurfürst Friedrich V. wurde aus
dem "Stückgarten", in dem die Geschütze (auch "Stücke"
genannt) standen, ein prachtvoller und weltberühmter Lustgarten,
der zum Ruhm des Herrschers beitrug. Der "Hortus Palatinus"
wurde in den Jahren 1614-1619 von dem aus London berufenen Salomon de
Caus geschaffen.
Zunächst kostete es gewaltige Anstrengungen, den Garten am Berghang
anzulegen: in über zweijähriger schwieriger Arbeit wurden auf
dem weiten Gelände östlich des Bergschlosses Terrassen angelegt,
die in einzelne Felder (Parterres) aufgeteilt wurden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Von der Schlossanlage hat man einen wunderbaren
Blick auf Heidelberg und den Neckar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
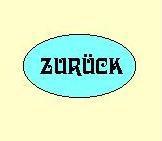 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|